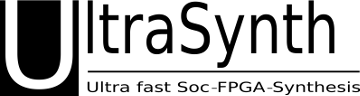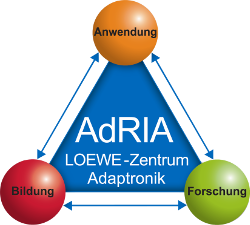| Dr.-Ing. Andreas Engel | ||
|---|---|---|---|
| Technische Universität Darmstadt | |||
| FB20 (Informatik) | |||
| FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen | |||
| Hochschulstr. 10 | |||
| D-64289 Darmstadt | |||
| Telefon: +49 6151 / 16-22430 | |||
| Fax: +49 6151 / 16-22422 | |||
| E-Mail: | 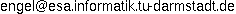 | ||
| S2/02 (Piloty-Gebäude), Raum E106 | |||
- Zeitraum
- 09/2015 - 02/2018
- Förderinstrument
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (KMU innovativ)
- Fördersumme
- 416 kEUR
- Projektpartner
- iXtronics Mechatronics, Tools & Technologies GmbH
- Ziegler Instruments GmbH
- Hella KGaA Hueck & Co
- Fachgebiet Rechensysteme, TU Darmstadt
- Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen, TU Darmstadt
- Projektbeschreibung
Aus diesem Grund muss die Plattform für die Serienhardware zu einem viel zu frühen Zeitpunkt der Entwicklung ausgewählt, gefertigt und manuell programmiert werden. Eine frühzeitige Festlegung der Hardwarearchitektur ist häufig nur schwer möglich, da der Leistungsbedarf für die noch zu entwickelnden Funktionen und Algorithmen noch nicht feststeht. Produktänderungen und Produktvarianten führen durch Hard- und Softwareanpassungen zu einer signifikanten Zeit-und Kostenerhöhung und verlangsamen den Entwicklungsprozess und die Markteinführung neuer Produkte erheblich. Eine modulare, flexible Hardwarearchitektur, die über den gesamten Entwicklungsprozess einsetzbar wäre, baut auf programmierbaren Chips, sogenannten SoC-FPGAs, auf, deren Programmierung jedoch fehlerträchtig und langwierig ist. Auch müssen die Entwickler die Synthese-Werkzeuge des FPGA-Herstellers bei sich betreiben,was erhebliche Lizenzkosten nach sich zieht. Ferner liegen die Laufzeiten der Synthese-Werkzeuge im Bereich mehrerer Stunden bis Tage.
An dieser Stelle setzt das Projekt UltraSynth mit einem hochinnovativen Lösungsweg an. Dazu wird, ausgehend vom Modell der Regelungsalgorithmen und -funktionen, mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs (Scheduler) und angepassten Hardware-Einheiten (sogenannte Reconfigurable Coarse Grain Architecture(CGRA)) der Code für das SoC-FPGA generiert(siehe Bild). UltraSynth verkürzt die Synthese des FPGAs von mehreren Stunden auf wenige Sekunden und erhöht somit die Produktivität und Reaktivität der Entwickler und damit die Planbarkeit der Entwicklung und die Qualität der Produkte erheblich.Zur Vermarktung und Verbreitung der Projektergebnisse integriert der Projektpartner iXtronics die von der TU Darmstadt entwickelte ultraschnelle Synthese und die angepassten Hardware-Einheiten in eine neue Toolbox seines Produkts CAMeL-View. Das ist eine etablierte Entwicklungsumgebung für den modellbasierten Entwurf komplexer technischer Systeme.
- Zeitraum
- 07/2008 - 06/2014
- Förderinstrument
- Hessische Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz
- Fördersumme
- 41,4 MEUR
- Projektpartner
- Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
- TU Darmstadt
- Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion
- Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen
- Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen
- Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik
- Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren
- Miktrotechnik und Elektromechanische Systeme
- Mikroelektronische Systeme
- Fachgebiet Regelungstechnik und Mechatronik
- Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
- Deutsches Kunststoff-Institut
- Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe
- Fachgebiet Dünne Schichten
- Fachgebiet Elektronische Materialeigenschaften
- Fachgebiet Disperse Feststoffe
- Fachgebiet Oberflächenforschung
- Fachgebiet Materialanalytik
- Fachgebiet Materialmodellierung
- Institut für Angewandte Geowissenschaften
- Hochschule Darmstadt
- Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftechnik
- Projektbeschreibung
- Als vorrangiges Ziel werden im LOEWE-Zentrum AdRIA (Adaptronik - Research, Innovation, Application) die erforderlichen wissenschaftlich-technologischen Themenfelder der Adaptronik konsequent in Tiefe und Breite weiterentwickelt, um eine systematische, ganzheitliche Entwicklung sowie einen hohen Marktreifegrad adaptronischer Produkte zu erreichen. Übergeordnetes technologisches Ziel ist es, mit Hilfe der Adaptronik einen nachhaltigen, konsequenten Leichtbau technischer Strukturen zu ermöglichen, bei sowohl gleichzeitig verbesserter Energieeffizienz über dem Lebenszyklus als auch erhöhter Funktionalität (z. B. integrierte aktive Sicherheitssysteme oder Selbstüberwachung) sowie Performancesteigerung (z.B. präzise, leise und schwingungsarm). Um diese Ziele zu erreichen, werden im LOEWE-Zentrum AdRIA sowohl Grundlagenforschung und Technologieentwicklung in definierten Technologiebereichen als auch die Technologiedemonstration anhand von drei exemplarischen Leitprojekten verfolgt. In der Aufbauphase des Zentrums liegt der Schwerpunkt dabei auf den grundlagenorientierten Technologiebereichen, wogegen in der Betriebsphase die anwendungsorientierten Leitprojekte im Vordergrund stehen. In den Technologiebereichen werden innovative Themen von strategischer Bedeutung für die Adaptronik soweit vorangetrieben, dass deren jeweilige Technologiereife auf gleich hohem Niveau liegen und deren Marktpotential dann in Leitprojekten demonstriert werden kann. Langfristig sollen diese Arbeiten dazu führen, die Schlüsseltechnologie Adaptronik in der Produktentwicklung für Massenmärkte zu etablieren und die nachhaltige Entwicklung des Adaptronik-Standortes Darmstadt zu stärken. Für die exemplarisch ausgewählten Anwendungsfälle Adaptives Auto, Leises Büro und Adaptive Tilger werden alle notwendigen Technologien im Sinne einer Produktwertschöpfungskette soweit weiterentwickelt und technologische Innovationen geschaffen, dass prototypische adaptive Systemlösungen umgesetzt werden können. Die Forschungsziele des LOEWE-Zentrums AdRIA leiten sich direkt aus der zugrunde liegenden Ausgangsituation und obigen Betrachtungen ab:
- Bereitstellung einer effizienten Entwicklungsumgebung zur Auslegung adaptronischer Systemlösungen,
- Entwicklung neuer, auf die Anwendungsfälle angepasster Wandlerwerkstoffe,
- Neue Aktor- und Sensorkonzepte, die einen hohen Grad der Integration in adaptronische Systeme erlauben,
- Kostengünstige, kompakte und robuste Lösungen für elektronische Komponenten eines adaptiven Systems,
- Innovative Regelkonzepte für komplexe Systeme bei breitbandigen Störungen,
- Kostengünstige, flexible Fertigungsverfahren sowohl für Klein- als auch Großserien,
- Methoden und Verfahren zur Bewertung und Überwachung der Systemzuverlässigkeit,
- Demonstration der Marktreife adaptronischer Systeme anhand ausgewählter Beispiele.